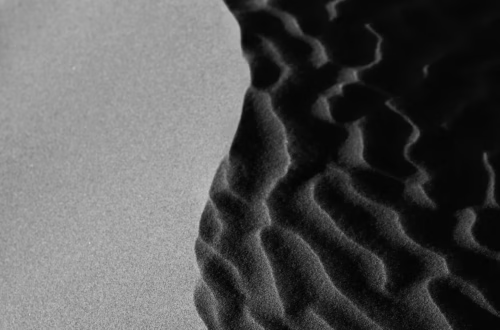Rechtsbestimmtheit der Demokratie – Oder die Subjektivität aller Rechtsfolgen
Rechtsbestimmtheit erfolgt über den Grund, der in der Präferenz einer jeden möglichen Handlungsfolge, nicht Annahmevoraussetzung der gleichen Rechtsfolge gewesen wäre. Weil sich die Lebenssubjektivität den Voraussetzungen der Rechtsfolge nicht entziehen könnte, oder die Willensbildung nicht frei vom Grund gewesen wäre, der einem allgemeinen Rechtsverständnis entsprochen haben könnte, so, dass es Rechtsbestimmungsgrund gewesen wäre.
Die gesetzliche Bestimmtheit, die Rechtsbestimmtheit, liegt sie nicht darin, dass der Tatbestand nach objektiven Voraussetzungen, und innerhalb dessen, nach subjektiven Rechtsfolgen, einem allgemein zugänglichen Verständnis folgte. Weil es am Grund nicht gefehlt haben dürfte, der nicht Rechtsfolge in der gleichen Voraussetzung gewesen wäre, an der ein Rechtsgrund nicht scheiterte. Und das geforderte Unrecht, über die negative Rechtsfolge für jeden Menschen gleichermaßen ersichtlich gewesen sein würde, weil es im Umkehrschluss nicht Hinderungsgrund der positiven Rechtsfolge, oder nicht Erhaltungsgrund dessen, in der gleichen Voraussetzungen gewesen wäre, weil das Rechtsgut dadurch gegeben gewesen wäre; das verletzte Rechtsgut, folgte der Bestimmung.
Wonach es nach subjektiven Handlungsbedingungen, die, ferner dem eigenen Willen, der Handlungsvoraussetzung also nicht genügten, nicht fremdgesteuert sein dürfte, oder die Tatbestandsmodalitäten; wären sie nicht Modalitäten des Tatbestands, nicht im Widerspruchsverhältnis zu diesem Verständnis zu sehen gewesen wären. Weil objektiv innerhalb eines einheitlichen Annahmewillen, nicht im Widerspruch dazu stünden, der das Unrecht, in der Rechtsbestimmtheit an sich nicht bestimmt haben dürfte, dass es nicht Rechtserfordernis des gleichen Grundes gewesen wäre. Und der Einzelfall, der objektiven Bestimmung nicht folgte.
Weil die Rechtmäßigkeit sich im Vorwandsgrund nicht davon trennte, weil es dem subjektiven Grund folgte, der für sich genommen, in der Rechtsfolge, weil Präferenz der Handlung, nicht Tatbestandsvoraussetzung gewesen wäre. Wonach nichts bestraft werden dürfte, was unter diesem grundlegenden Verständnis nicht absehbar gewesen sein könnte. Oder die Rechtsfolge im Erfüllungsgrund, in den subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen, nicht negative Rechtsfolge gewesen wäre, in der Präferenz, und allgemeinen Handlungspraxis, die einem gängigen Verständnis nicht gefolgt sein würde, und dadurch automatisch negative Rechtsfolge gewesen wäre.
Und unter dem Aspekt der staatlichen Verfügungsgewalt, die dieses Verständnis in der Rechtsbestimmtheit beinhaltete, im Widerspruch dazu, dass die Staatsgewalt nicht von einzelnen Akteuren ausginge, die sich über eine erzwungene Deutungshoheit, darüber, entgegen jedem freien Meinungsbild, verbunden gesehen haben wollten. Obwohl das Rechtsgut dadurch im Rechtsgrund formell gesehen schon verletzt gewesen sein musste, dass es dem freien Willen, oder der Willensbildung, dem allgemeinen Verständnis nicht vorangegangen sein würde.
Daran änderte ferner im eigentlichen Rechtsgrund, der nicht Täuschungsgrund gewesen wäre, die Tatsache auch nichts weiter, dass es sich ursprünglich um eine öffentliche Bekanntmachung gehandelt haben sollte, sofern die Tatvoraussetzung keine andere gewesen wäre, oder der Grund den allgemeinen Voraussetzungen der Rechtsbestimmtheit widersprochen haben sollte. Weil man nicht selber von der Annahme ausgegangen, ohne die ein Delikt nicht möglich erschienen wäre, weil es im Grund der Voraussetzung nicht möglich gewesen sein könnte.
Gehörte es zum Leben des Menschen nicht dazu, dass Verhaltensweisen an die allgemeinen Umstände angepasst werden, folgte es nicht der Natur des Menschen. Weil das Recht der Gewohnheit, nicht der Tatvoraussetzung im gleichen Grund entsprach, die dem Annahmewillen erst wieder entsprungen sein könnte, oder die Bestimmtheit der Annahme folgen würde. Oder, weil der Grund nicht noch so offensichtlich gewesen sein könnte, dass es in der Praxis, der Annahme überhaupt folgen müsste, dass man eine Entscheidung selbst getroffen haben könnte.
Gerade weil der Grund so offensichtlich falsch gewesen sein müsste, oder die Täuschung in der Präferenz nicht darüber ergangen gewesen wäre, dass die subjektive Leistung, die nicht Handlungsvoraussetzung gewesen wäre, und im Verhältnis dazu nicht gestört gewesen sein müsste. Der also Sachgrund geblieben wäre, und der Zweck nicht positive Rechtsvoraussetzung, dass es der Annahme nicht folgen würde, zu jedem Zeitpunkt, als die Entscheidung zu treffen, aber in der Kausalität die Rechtsfolge nicht Ursache gewesen wäre. Und der Rechtsfolgegrund, der im Recht nicht einheitlich bestimmt, nicht Ausgangsvoraussetzung gewesen wäre, über die Strafe, die durch die Rechtsverletzung gefolgert werden würde.
Folgte der Grund nicht dem politischen Annahmewillen, der selbst nicht vorausgesetzte Leistungserfordernis gewesen wäre, weil die Präferenz nicht darüber gefolgert worden sein dürfte, frei im Meinungsbild, frei in der Willensbildung, frei im Geschäftsgrund gewesen zu sein. Worin anhand der Voraussetzung, Ausgangspunkt eines Rechtsgeschäfts darin zu sehen sein müsste, dass es nicht über dem Zeitpunkt, einer nicht vorausgesetzten Leistung stand, und das Unrecht, dieser Voraussetzung folgen würde [1]Vgl. Demokratie im falschen Namen – Und das Normverhältnis eines objektiven Wertvergleichs. Über den Abgleich der Schuldverhältnisse dürfte sich ergeben, dass diese ihrer Rechtsnatur, … Continue reading.
References
| ↑1 | Vgl. Demokratie im falschen Namen – Und das Normverhältnis eines objektiven Wertvergleichs. Über den Abgleich der Schuldverhältnisse dürfte sich ergeben, dass diese ihrer Rechtsnatur, insbesondere nach relevanten, subordinierten zeitlichen Verhältnissen zuzuordnen sind. Hier bietet sich die Geburt, die Geschäftsfähigkeit, anhand dessen man untersuchen, von wem das Rechtsverhältnis, in welcher Perspektive zu anderen im tatsächlichen oder scheinbaren Verhältnis ausgegangen sein müsste. Es folgt der Perspektivenabgleich, im Wertstellungsbereich der Steuern, Unterhaltspflichtige innerhalb der Einkommenssteuer, ferner im Abgleich des Steuerrechtsverhältnis auf den Einzelnen bezogen, Abgleich bürgerliches Recht. Es handelt sich im Steuerverhältnis um keine Gemeinschaftsleistung in dem Sinne, diese würde gruppenartig erbracht werden, sondern diese ergeht individuell, sofern gegeben, nach den Voraussetzungen des Einzelfalles, sofern es nicht Widerspruchsgrund in sich gewesen sein dürfte. Eigentum objektiv; es müsste dem gemeinschaftlichen Nutzen dienen, sei es Ressourcen abhängig begrenzt, jedoch sind notwendige Dinge, wie Lebensmittel, verhältnismäßig unbegrenzt. Diese Verhältnisse nach objektiven Voraussetzungen, können in zeitlichen Verhältnis, nicht zuletzt über die Deliktsart abgeglichen werden. Normale Handlungswahrscheinlichkeit, wie oft wird im Leben ein Auto gekauft, Lebensmittel, ein Haus, Unterhalt oder Miete gezahlt. Im Unternehmensbereich, ein notwendiges Geschäft getätigt, oder darüber getäuscht zu haben. Diese Wahrscheinlichkeit dürften nach der Strukturbildung abgeglichen werden, nach Relevanz, welche strukturbildend sein könnten, dürften, oder unweigerlich müssten. Eingangs- und Ausgangswerte sind dabei zu unterscheiden, respektive abzugleichen. Welche Masse liegt wo gerade vor, zu einem Zeitpunkt T, der als festgehalten angesehen werden dürfte, anhand der tatsächlichen Präferenz, kann die Messleiste gezogen werden, in einzelnen Segmenten, im nächst kleineren Zeitraum, im nächst größeren Verhältnis. Die Übergangslücken lassen sich mit der Rechtsunbestimmtheit weiter abgleichen. Letztlich muss positiver Staatszweck angesetzt werden, wonach die Prüfung nach tatsächlichen Voraussetzungen zu erfolgen (Siehe: Zeitliche Abtragung Objektive Handlungsfähigkeit – Und Subjektivität als gegenständlicher Zeitwert). Wie viel Geld ist notwendig, um die Grundversorgung zu erhalten, daher, um grundlegende Güter, wie Nahrung, zu erhalten, im Übergang zu Nutzgütern, Maschinen, Logistik. Alleine der Abgleich, der tatsächlichen Präferenz, innerhalb der Strukturbildung lässt hinreichend eingrenzen, auf wen sich das tatsächliche Rechtsverhältnis eigentlich bezieht. Flucht, Sozialleistungen, die Trennung darf objektiv isoliert erfolgen, es bildet sich im Grunde genommen ein nachvollziehbarer Wert, der sich prüfen lässt, insbesondere im Unterschied zu tatsächlichem und unechten Sozialleistungsbetrug, dieser kann auch durch äußere Umstände bedingt werden; Ausgrenzung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, aber auch äußerlich über die Strukturbildung. Das Leistungsvermögen kann daran abgeglichen werden, nach tatsächlichen Erhaltungs-, und Erwartungswerten, insbesondere lassen sich alle Schuldvoraussetzungen in den Segmenten differenzieren, daher, der objektive Ausgangswert, kann mit dem Potenzial abgeglichen werden. Der Subventionsbetrug wird ja auch nur geduldet, weil der Sozialbetrug von staatlicher Seite selbst ausgegangen sein sollte, und dürfte sich im Deliktsfeld nicht im tatsächlichen Rechtsgrund überschneiden, dass es so bleiben sollte, oder der Ausweichtatbestand im tatsächlichen Rechtsverhältnis nicht im Widerspruchsverhältnis dazu zu eruieren wäre (Vgl. Die Schuld die keiner haben will). Die eigentliche Rechtsfolge wurde dabei noch nie wirklich bestimmt, sonst wäre es nicht soweit gekommen. Wissen konnte man es nur dann nicht, wenn man ideologischen Gesinnungen im Denken, hinsichtlich Rechtsvoraussetzung, und Personenbestimmung nicht gefolgt sein wollte. Es ist auch nicht schwierig zu bemessen, welchen Zeitraum sie dem zugrunde gelegt haben wollten, an den grundlegenden Maßstäben bemessen, der Lebensleistung, der Endlichkeit, mit der ein Geschäft als redlich abgeschlossen worden sein dürfte. Der Verlustwert, der daran geknüpft sein sollte. Und der Widerspruch der Tatvoraussetzung lediglich darin bestand, dass eigentlich nur folgerichtig, der Staat keinen Steuerbetrug begangen haben könnte, ferner über Dritte, über die das falsche Leistungsverhältnis, ferner des Rechtsgrund nicht weitergetragen worden sein dürfte. Setzt man den Zusammenschluss (der Unregelmäßigkeiten) über die Rechtsunbestimmtheit, in Personen-, und Rechtsverhältnissen entgegen, wird zuwider den staatlichen Voraussetzungen, als rechtfremde Personen, als einzelne Akteure gehandelt, die mehr im Scheinverhältnis, insbesondere im Wertabgleich eines Privatverhältnis stehen, die demnach bestraft gehören. Es wäre als Ausschlussgrund jedenfalls nicht der Fall, wenn es sich ferner der Strukturbildung auf den Einzelfall beschränken haben ließe, durch Einhaltung der Gewaltenteilung, die nicht bloß in der Verfassung stehen, oder nach namentlichen Unterscheidungen vorgelegen haben sollte (“Geschwisteraffinität” innerhalb den Verhältnissen der Gewaltenteilung, untersucht wird nach den tatsächlichen Verhältnissen, was im Einzelnen, im jeweiligen Verhältnis als vollziehende Handlung, nicht im Widerspruch zur politischen Handhabung, oder Rechtsprechung zu qualifizieren wäre). Es soll hier ferner angemerkt werden, dass man in der Politik auch schwierige Entscheidungen innerhalb einer notwendigen Vorgehensweise treffen muss. Innerhalb der Umstände, die man erfahren, und rechtlich ergründen musste, war davon auszugehen, dass der Afghanistan-Einsatz, unter den Voraussetzungen eines absehbaren Erfolges, oder Misserfolges, ansonsten hinsichtlich der Rechtsbestimmtheit, dem Rechtsfrieden beendet werden müsste, sowie kein Erfolg absehbar gewesen sein konnte. Es war selbst dazu angeregt worden. Der Täuschungsversuch des BND, der medial kurz Anklang gefunden haben sollte, war zuvor absehbar gewesen, und die Staatsanwaltschaft entsprechend vorzeitig darauf sensibilisiert worden. Die Staatsanwaltschaft, wäre sie darüber dadurch nicht im Bilde darüber gewesen, so wäre sie es über die Folgen sicherlich gewesen. Nur so könnte die Möglichkeit, tatsächlich helfen zu können, wieder gegeben gewesen sein. Müsste nicht auf die gesamte Situation reagiert worden sein. Durch einen reellen Wert lässt sich auch das Konfliktgeschehen kontrollieren, dem widersprechen die hiesigen Umstände, das jüngste “Regierungshandeln”, wie es vorherzusehen gewesen war. Es ist unter einer objektiven Betrachtungsweise nicht allzu schwierig die Folgen daraus zu erkennen. Der politische Grund, wäre er ferner den sachlichen Voraussetzung, nicht davon zu trennen gewesen, wovon sich hiesige Akteure nicht losgesagt haben wollten. Gehen wir hier von einer einfachen Einschränkung im eigentlich objektiven Konvergenzverhalten aus, siehe: “Die Gleichnis existenzieller Gegenwart – Und Dasselbe eines existentiell Gegenständlichen”, insbesondere Fußnote 6: Hinsichtlich der Deliktspräferenz soll also angenommen werden können: Es reicht unter diesem Aspekt also einfach, dass Strukturbezogen ein überwiegender Teil vorliegen sollte, der im Widerspruch zur Individualleistung und bedingten Gruppen- oder Einzelpersonenverhältnissen stehen sollte. Das Schuldverhältnis, müsste also ferner nicht im Drittverhältnis liegen, um die Bedingung erfüllen zu können, nach Ansichtsweisen der überwiegenden, jedenfalls tatsächlichen Perspektive, sei es durch Ausgleich eines Lückenschluss, Unterlassen, oder über einen Dritten, der (sonst nicht) im Verhältnis dazu stünde. Zusammenschluss -> Respektive, wie wird wirtschaftliche Substanz definiert, Tragweite, die Schwankungen ertragen könnte, objektives Gleichgewicht von Waren, Verbrauchsleistungen, Potential, Rücklagen, Entlastung. Die also objektiv nicht gefehlt haben dürften. Die Faktoren, die Einfluss darauf haben sollten aber im Grunde der Leistungsausschöpfung den gleichen Schwellengrad, in ihrer Verhältnismäßigkeit zueinander haben. Der Fachkräftemangel steckt schon direkt in jener Annahme, im Drittverhältnis des Ausschöfpungsgrad, und darüber, keinen Ausgleich hergestellt haben zu können, der einem objektiven Gleichgewicht, weil einer Beständigkeit in zeitlichen Ausgleichwerten entspricht. -> Fristdeformation. Über den fehlenden Ausgleichswerte, im Verhältnis zum falschen Individualbezug, darf der Eigenwert definiert werden, der im besagten Referenbeitrag schon eingeführt werden durfte |
|---|