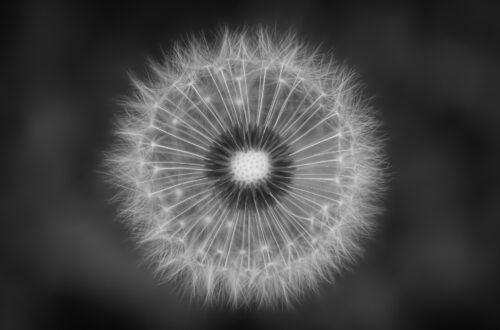Die Individualität – Die Individualität des Menschen
Die Individualität, sonderbar die Individualität des Menschen, ist kein Phänomen einfältiger Singularitäten an menschenwesentlichen Merkmalen, an Merkmalsformen. Wäre die Vielfältigkeit hier nicht die Deutungsmöglichkeit der eigenen Existenzform, die von einem Merkmal keinen von Grund auf verschiedenen Teil eines anderweitig singulären Subjektes bildete.
Ein einziger Mensch kennt keine ganz eigene, nur seine ganz eigene, die menschenwesentliche Individualität[1]Es kann hier erstmal als ein formelles Kriterium der subjektiven Wahrnehmung verstanden werden; also auf eine rein logische Folgerung schließend; ein Mensch, durch Zufall alleine an einem, … Continue reading. Erst der jeweils nächste Mensch identifiziert die Individualität zum jeweilig seinesgleichen Menschen, im Menschen des Menschen selbst sein.
Erster Individualitätsgrundsatz des Menschen
Der deutsamen Vielfältigkeit aller eigenen Merkmale eines jeden Menschen unterliegt ein universell koäquivalentes im Gegenüber, in den eigenen menschlichen Merkmalen, aller Menschen, in den menschenwesentlichen Nuancen an einer eigens nicht endlich schwindenden Grenzwertigkeit zur Gleichheit, als Individualitätsvoraussetzung des Menschen in seiner Individualität als Wesen zueinander.
Wobei das universell koäquivalente Merkmal im Gegenüber, letztlich nur dem ein und alles verbindenden Teil des Menschen, im Menschensein, noch in seiner ganz eigenen Natur vor der Schöpfung des Natürlichen als solchen, dem eigentlich Wesentlichen im Natürlichen gleich kommt. Es aber niemals das Gleiche ist, was für den Menschen seine Wesenheit als solche, im Sein seiner eigentlich ganz eigenen Einzigartigkeit von aller Existenz, einzig und alleine ausgemacht haben würde. Als das Alleinstellungsmerkmal, dem sich selbst eigentlich niemand gegenüber zu sein sieht. Es also auch niemals einzig und alleine derselbe Mensch, in seinen eigenen menschenwesentlichen Merkmalen des Natürlichen gewesen ist, der die Individualität des Menschen als solche vor seiner Natur als Ganzes erst einmal ausgemacht haben könnte. Gleichsam, in Bezug auf alle natürliche Existenz und alle natürlichen Wesen[2]Das Menschsein ist geprägt vom Bewusstsein, seiner Wahrnehmung. Alleine die äußere Erscheinungsform eines Menschen, mag sie über den Wesensgrund selbst informell für sich gesehen, differente … Continue reading.
Die natürliche Individualität des Menschen selbst sein
Der jeweils nächste Mensch, ist des seinesgleichen Selbst sein, in der Existenz desselben vor dem Sein als solchen.
Das relative Gegensatzprinzip erübrigt sich hier im Teil der eigentlichen Deutung, im Sinne eines anderen Menschen, in der Gesamtheit des menschlichen Individualitätsausdrucks[3]“Die Gleichnis existenzieller Gegenwart – Und Dasselbe eines existentiell Gegenständlichen”.
Womit das Phänomen der Individualität des Menschen selbst, bloß die Erkenntnis alleine in ihrer eigenen Vorstellung, an dessen ist, was sie unabhängig von der natürlichen Schöpfung, und ihrer individuellen Entstehung des natürlichen Wesens von sich aus eigentlich nicht gewesen ist. Es also eigentlich niemals in seiner Selbst, als eine eigene Individualform des Natürlichen als existent vorauszusetzen gewesen ist, in dem Wesen eigentlich nur ganz natürlicher Existenz, des Menschen im Menschen selbst sein.
References
| ↑1 | Es kann hier erstmal als ein formelles Kriterium der subjektiven Wahrnehmung verstanden werden; also auf eine rein logische Folgerung schließend; ein Mensch, durch Zufall alleine an einem, hinsichtlich dessen, eingegrenzten Ort, würde er seinesgleichen nicht finden können, folglich gäbe es keinen Vergleich im selbst nicht relativen Gegensatz, dem der Zufall nicht schon unterlag, bei bedingt selbst erkenntlichen Merkmalen, einer gesteigerten Wesensform, hinsichtlich von äußerlich abgrenzbaren Merkmalen einer subjektiven Daseinsform, selbst das eigene Spiegelbild wäre es dafür nicht ausreichend, um zu sehen, wer man selbst nicht wäre, beispielsweise an einer glatten Wasseroberfläche. Von der physischen Voraussetzung, bedarf es dazu also keiner positiven Bestätigungsform dieses Kriterium, für wie wahrscheinlich, oder unwahrscheinlich man es als formelle Voraussetzung auch gehalten haben möge, in Abgrenzung nicht wesentlicher Merkmale, die das eigene Dasein, unabhängig davon nicht widerlegten. Weil das Gesehene, das Ertastete, nicht man selbst, oder formell nicht das im Sinne des Merkmals komplementäre Gegenstück dazu gewesen wäre. Ob nun andere Lebewesen darin mit einzubeziehen wären, andere Lebensformen, um das Kriterium, alleine anhand des Menschlichen, darin auch nicht selbst zu bedingen, um vom natürlichen Ursprung nicht verschieden, jedenfalls selbst individuell gewesen zu sein. Weil anhand der Merkmale, kein im Wesentlichen der subjektiven Wahrnehmung, objektiver Vergleich gegeben wäre [Ein wahrscheinlicher Grund, weshalb die Vielfalt so erstaunlich sein sollte, von jungen Jahren an, wenn man die Lebewesen in einer Artenvielfalt gerade erst kennenlernt]. Hier ergibt sich das Kriterium für das relative Drittverhältnis, wären zwei objektiv eigentlich schon individuelle Menschen, oder formell zwei Individuen in der eigentlichen Gleichheit eines selbst koäquivalenten Merkmals eines Wesenszuges darin nicht Wiederum verschieden als jeweils individuell anzusehen, als eigentliche Minimumbedingung der eigenen Existenzform, jeweils im Verhältnis gegenüber einem anderen Menschen gesehen: vgl. Das relative Gegensatzprinzip – Und das Unendlichkeitsverhältnis individueller Deutungsmöglichkeiten. Denn zwei Menschen sehen einander das “andere Gleiche”, weder der eine, noch der andere Mensch weiß wer er im Gegensatz dazu selbst nicht wäre; der selbst nicht Abbild eines, oder seines eigenen Spiegelbildes (geworden) wäre, in dem Wissen, dass sich das Selbst der eigenen Wahrnehmung darin nicht unendlich teilte, weil nicht selbstverständlich, nicht unteilbar, oder selbst nicht individuell gesehen. Die Gestikulation der eigenen Fassung, der eigenen Ausdrucksweise, in einem selbst nicht erkennen zu können. Das eigene Gesicht, kann man selbst nicht sehen. Fehlte es in der selbst eigenen Individualität nicht am Folgeschluss, am Bedeutungswert, in dem man eine Bestätigung fand, die keine andere Annahme zuließe, so wäre das Dasein für einen Menschen nicht vergeben, das eigene Antlitz, wäre es nicht das des Menschen. Sollte man nicht annehmen wollen, das eigene Spiegelbild, würde es Aufschluss gegeben, über eigene Mimik, über das eigene Individualitätsbildnis, eines Gesichtes. Doch, da diese, wie ihre Merkmalsformen erst im reduktiven Vergleich des allgemeinen menschichen Individualitätsausdruck eine Bedeutung erfährt, die Lebensgegenwart dem in nichts nach steht, steht es hinter der eigenen Bedeutung, die der Lebensgegenwart nicht vorangegangen ist. Wonach das Ansehen nach eigenen Merkmalsformen für sich selbst erkenntlich geworden sein dürfte, der Wahrnehmung in nichts stünde. Doch dies Widerspricht dem Ursprung der Natur des Menschen, evolutionsgeleitet, unter lebensrealen Bedingungen, im Heranwachsen, in der Bedeutung des Lebens, der Lebendigkeit. Der leere Ausdruck, bliebe er nicht dahinter zurück, stünde das subjektive Empfinden nicht im Vordergrund, und im universellen Ausdruck, dass die beinahe Unendlichkeit die Gewissheit nicht ermöglichte, überzeugt von der eigenen Individualität gewesen zu sein. So, wie sich aus keiner vereinzelten, oder für sich gesehen eigenen, vereinzelten Wahrnehmung eines anderen, als nicht gleichen Abbildes, im Ebenbild eines eigenen Spiegelbildes, in Form, und Erscheinung eines anderen Menschen, ein für sich genommen nicht widerlegbarer Vergleich ergab, der es sinngemäß, der eigenen Wahrnehmung entsprechend, bewahrheitet haben würde, müsste es dafür nicht erst Teil eines universellen Ausdrucks geworden sein. Wenn die eigene Individualität, selbst nicht abschließend erkannt sein kann. Bis hin zur Unendlichkeitsform, also bei objektiv unendlich vielen Menschen, die selbst bei hinreichend vielen Menschen, unterbewusst ohnehin bestehen sollte, bei Auffassung einer Welt, nach der die Menschen auch außerhalb eines subjektiven Wahrnehmungsraumes mit Gewissheit lebten, aber bei friedfertigen Gesinnungen auch im tatsächlichen Sinne, worin die Individualität des Menschen in ganzer Kraft zum Ausdruck kommen kann. Es ist eine Verneinung, eine Unsicherheit, die erst mit dem Leben, und dem Schutz des Lebens ihre Widerlegung fand, in der Vorsicht, und Rücksichtnahme, in der Liebe, die man im Dasein teilte, Mensch, und als Mensch individuell zu sein. Es spiegelt unser Aufstehen wieder, das Schlafengehen, unsere Gewohnheiten als menschliche Wesen, etwas besonderes, soziale Kontakte gepflegt zu haben. Manche Abgeschiedenheit, den Tag in der Werkstatt, Stunden im Büro verbracht zu haben, um sich seiner darin Gerecht geworden zu sein, und selbst Teil daran gehabt zu haben, in einer Gemeinschaft gelebt zu haben. An manchen dunklen Tagen, in den frühen Morgenstunden rauszufahren, Tage, Wochen, Monate auf See, zur Arbeit, um den Weg wieder nach Hause zu finden, auf Entdeckungsreisen, manchmal, nie wieder gekehrt, und noch für immer da geblieben, bis an die entlegensten Orte, auf der Suche nach Neuem, auf Entdeckungsreisen nach Zahlen, physikalischen Errungenschaften, bis an die Grenzen des Menschenmöglichen. Für jemanden weiterzumachen, Tag für Tag, und ihn im Herzen wie der Lebenszeit, niemals alleine gelassen zu haben, mit manchen Aufgaben des Lebens, mit manchen Schicksalsgründen, jemand für immer ein Freund geblieben zu sein, und die Liebe mit einem Menschen zu teilen. Durch gemeinsame Vorstellungen, einer natürlichen Verständnisform, über die eigene Existenz geeint. Natürlich widerlegt sich die Allgegenwärtigkeit der eigenen individuellen Deutung nicht, im Heranwachsen, unter dem Aspekt der Geborgenheit seit dem Moment, das Licht der Welt erblickt, und andere Mitmenschen wahrgenommen zu haben. Doch historisch bemisst sich daran keine Selbstverständlichkeit, um die Geborgenheit als eine nicht unbedingte Voraussetzung dafür anzusehen, in dem Sinne, die menschlichen Entwicklung trüge in diesem Bedeutungswert jedes Verständnis, dass es vom Natürlichen nicht verschieden gewesen wäre, vom Urgrund dieses Verständnis, vom natürlichen Ursprung in sich gesehen, um den Menschen anzugehören. Im Überlebenskampf, dass gewisse Eigenschaften nicht die Überlegenheit der eigenen Daseinsform im Bilde der Evolution unlängst sicherten. Diese Entwicklung liegt auch im Hinterfragen, dem Argwohn, dem sich die Eigenständigkeit darin nicht weiter teilte, um menschlich, in einer sozialen Gruppe, einander darüber verbunden gewesen zu sein. Doch so wäre jede menschliche Schwäche darin selbsterklärend, diese Deutung selbst zu fassen. Es dürfte also zu einer gewissen Entfremdung führen, das Sinnesbild des Menschlichen dennoch für sich selbst in sich getragen haben zu wollen. Trotz des Selbstverständnis, andere Menschen darin erkannt, und sich einander individualisiert zu haben, führte es nicht auf die natürlichen, evolutionären Ursprünge zurück, dem die Bedeutung an dessen, im erreichbaren Verständnis, das Lebensbild einst offenbaren ließen. Diese Selbstverständlichkeit bewirkt also auch eine Entfremdung. Diese Tatsache ergründet sich nicht darin, sich dessen bewusst geworden zu sein, sondern, sich dennoch fortwährend darauf eingelassen zu haben, trotz der Gewohnheit, und unter einer gewissen Notwendigkeit, den einzelnen Menschen geachtet zu haben. Ein Ursprung, der sich in der Deutung davon nicht unterscheidet, in dem Bewusstsein selbst ein Mensch gewesen zu sein. Bemisst sich selbst in psychologischer Hinsicht unter diesen Verhältnissen nicht das Alleinsein, oder die Angst davor alleine gewesen zu sein, die Einsamkeit, die Ängste gegenüber einem objektiv Unbekannten, dass es der eigenen Anschauung in zwanghaften Vorstellungen nicht weiter diente, nicht akzeptiert sein wollte, im Sinnbild des Verstandes, der über das formelle Kriterium der eigenen Vorstellungen hinsichtlich dessen nicht hinausgegangen sein würde, im Selbstbild, davon verschieden, oder unterschieden davon gewesen zu sein. Individualität liegt hier nicht mehr alleine in der Vorstellung eines anderen Ansehen, eines anderen Gleichen, an nicht eigentlichen Merkmalen, als eine assimilierte Form eines anderen als dem gegenwärtigen Bewusstsein, im Verhältnis zur assimilierten Form eines anderen Gleichen, der in der Unterscheidung nicht darauf zurückzuführen gewesen sein dürfte. Die sich in Gefühlen, und gewiss im anderen Geschlecht, umso mehr einfühlen lassen, bei selbst jedem kläglichen Versuch, bei einem immer noch unausgereiften Verständnis, eigentlich nur trotz allem Wissen, besonders darüber, wohl niemals ganz Gewissheit darüber erlangen zu können, was ein Mensch, an und für sich selbst sonst niemals gewesen wäre, dass es schier unfassbare, unbegreifliche; das Verletzliche, und große Stärke, so unglaublich schöne Gefühle und Empfindungen hervorrufen kann. Das Vertrauen, wenngleich man es auch nicht gleich mit einschließe; erkannte man im selbst womöglich immer noch fremden, nicht sich selber. Und im Wagemut darüber, steckt selbst schon etwas Liebe, wäre es eigentlich kaum vorstellbar erschienen, was gemeinsam entstehen könnte, selbst an neuem Leben. Und wäre es von allem Guten nicht verschieden, dann läge darin nicht der Grund, warum Ereignisse und Entwicklungen scheinbar nicht greifbar, wenngleich vielleicht nicht gleich vorhersehbar, aber im Bewusstsein nicht getrennt, so unfassbar erscheinen mögen, in den Trübungen jener Ansichtsweisen, und darauf beruhenden Vorstellungen eines nicht gleich ideellen, aber in der Surrealität, sonst nicht unrealistischen Zustandsbildes. Weshalb das eigentlich nur Offensichtliche, selbst an Einzelereignissen; mag es anhand von Indizien, und Erfahrungen aufgrund gleich bleibenden Folgen eigentlich noch so geläufig erschienen, also von der eigenen Ansichtsweise eines einzelnen Menschen, selbst nicht zu unterscheiden gewesen sein; sähe man es nicht für sich selbst, in einem künstlichen Zustandsbild von allem, an allem, was darin noch folgen würde. Das über die subjektive Wahrnehmung hinausgegangen sein müsste, in der Vorstellung eines darin eigentlich nicht länger unbekannten Bösen des Menschen, wäre das Unbekannte darin nicht zu fassen gewesen, als der Inbegriff dessen, sich seinen Ängsten, in der subjektiven Umgebung nicht gestellt zu haben, die im Sinnbild eines Betrachters surreal erschienen sein mögen. Der Grund, eines vermeintlich nicht immer Gleichen, an allem Gewöhnlichen, oder Bösen, oder einem unausgesprochen Guten darin zu sehen. Trotz oder wegen der Annahme, es dürfte, oder es müsste eigentlich schon immer so gewesen sein, im Bilde der Evolution, die diese Annahme zeitgemäß sicherte. Die Erkenntnis geht keinem anderen Bewusstsein nicht voran, es wäre bei allem Selbstverständnis nicht nicht, die nicht selbst erfasste Wahrnehmung, die dem geläuterten Wissen darüber nicht unlängst schon vorangegangen sein dürfte, der Mensch, wäre er nicht Mensch, der dem eigenen Selbstbild nicht entsprach. Über die Fähigkeit, ein Bewusstsein darüber gebildet haben zu können, dass sich in der Annahme nicht in der eigenen Individualform wieder widersprochen haben würde, ein Mensch gewesen zu sein. Weil von dreien es auch eigentlich keiner wissen könnte, selbst individuell im Verhältnis zum jeweils anderen gewesen zu sein, in der Menge nicht bedeutend, oder im gestörten Drittverhältnis, denen die Anwesenheit anderer im Geiste nicht innewohnt, einander Mensch zu sein, läge darin nicht die Entfremdung des Menschen selbst, und darüber anderseits die Parität innerhalb jener Verhältnisse nicht zugrunde. Die Entfremdung vom natürlichen Urbildnis des Menschen, dürfte diese trotz strukturell bedingter Anbindungen, einer modernen Welt, also einer angenommenen Deutungsakzeptanz, nicht bei einem einzelnen, alleine dadurch selbst individualisierten Menschen liegen. So steht unter normativen Verhältnissen der Deutungsakzeptanz eine absolute Entscheidungsgewalt im Widerspruch dazu. Und bei einer Überschreitung, nicht über dem normativen Regelungsbedarf, menschlich, als nicht notwendigerweise, um mit gegebenen Bedingungen überhaupt im Einklang gestanden haben zu können. Die also trotz, oder aber, nicht wegen der Annahme, verhältnismäßig ungleich im Wesenszustand geworden sein dürften, an dem sich die Übereinkunft des Gegenwärtigen, weil existentiell nicht Gegenständlichen, nicht weiter erkennen ließe. Das eigene menschliche Handeln, läge es nicht in der Vergegenwärtigung dessen, aber gewiss in der existenziellen Bedeutungsfrage, die der Mensch seit jeher ergründet haben müsste. Wonach der Mensch seinen natürlichen Ursprung, der, beim Abscheiden aller gewöhnlichen Größen, jeder Handlung innewohnen sollte, nicht verkannt worden sein dürfte. Würde er nicht stets Entstehungsgrund der menschlichen Natur, und seiner Entwicklung geblieben sein. So verhält sich dieses Kriterium nicht uneindeutig, in der Frage, die den Menschen, und sein Verhalten, in ihrer stetigen Beantwortung alleine normativ definiert haben würden. Und in einer Unterschreitung, weil diese im Widerspruch dazu stünden, bedingterweise an formelle Kriterien der subjektiven Wahrnehmung gebunden gewesen zu sein. So bliebe der Widerspruch erhalten, der nicht im Gegensatz zur individuellen Verhaltensakzeptanz stünde, das Bewusstsein, ginge es über die Frage dieser Bedeutung nicht hinaus, wie eine Akzeptanzform, die Andersdenkende ausgeschlossen haben wollte. Der Mensch, wäre er von diesem Bewusstsein nicht geleitet, der die Anerkennung einer gemeinsamen Natur vermied, die nicht gleich seiner individuellen Deutungsmöglichkeit geblieben wäre. Die Individualform bezieht sich auf objektive Wahrnehmung, sie ist nur in der Wahrnehmung anderer Menschen sichtbar, in der Verhaltensakzeptanz, in der Achtung durch andere Menschen, in einer von Natur aus gegebenen Kraft, die sich anderseits im Sinnesbezug von eigener menschlicher Schwäche auf die Leichtfertigkeit und Gutgläubigkeit beziehen kann, in einem Machtmissbrauch der eigenen individuellen Daseinsform. Dieses Phänomen steckt im Normverhältnis des Verhaltens somit auch in der Abweichung von jeder gesellschaftlichen Norm im menschlichen Verhalten, in der Begehung von Straftaten, einerseits bezogen auf die Einzelperson, etwa in Beziehungstaten, in einem außergewöhnlichen Geltungsanspruch in der Übertreibung jeder Darbietung, sei es durch Eigentumsdelikte, um den Wertvergleich der eigenen Bedeutungsakzeptanz herausstellen zu können, anderseits bei Massenphänomenen, in dem Bewusstsein von willkürlich anmutenden Taten, im Umkehrverhältnis des eigentlich individuellen Akzeptanzverhaltens, bei denen das Individuum eine untergeordnete Rolle spielen sollte, bei Vernichtungskriegen, Handlungen, die das Individuum unkenntlich werden lassen, oder, die dem Menschen einen Ausdruck darüber anerkennen lassen könnten, in dem das Opfer darüber hinaus geehrt würde, weil es einem höheren Zweck gedient haben könnte, in einer kultureigenen, oder gattungsgleichen Anerkennung, in der Ausübung durch eine Obrigkeit, einem Staat, im Verhältnis gegenüber anderen, der im falschen Bewusstsein der Individualität seine Werte mutmaßlichst verteidigt haben wollte, in dem es Krieg erst führte. Worin das formelle Kriterium in Missbrauchsformen eine andere, verfälschte Bedeutung erlangt, die es vom eigentlichen Bewusstsein des menschlichen Ausdrucks trennt. Denn die Objektivität vermittelt sich dabei in einem anderen Ausdruck dieses eigentlich eigenständigen Bewusstsein, dass es mutmaßlich selbst übergeordneter Natur gewesen sein könnte, verfälscht, und normgerecht falsch bleibt es, weil die teilgleiche Anerkennung eines individuellen Ausdrucks nur durch andere möglich sein kann |
|---|---|
| ↑2 | Das Menschsein ist geprägt vom Bewusstsein, seiner Wahrnehmung. Alleine die äußere Erscheinungsform eines Menschen, mag sie über den Wesensgrund selbst informell für sich gesehen, differente Wesenszüge aufweisen, als formindividuelle Fomgröße, sei es in der Ausgestaltung eines Formmerkmals, einer eigenen Gliederform, in einem direkten Vergleichszustand dieser Größe, in Faltenlinien, auf den Händen, den Fingern, in bestimmten Pigmentanteile der Augenfarbe. Doch Seele, Bewusstsein ist Teil der Ausprägung. Die selbst im evolutionär physiologisch-biologischen Teil des Menschen eine individuelle Ausprägung erfährt. Durch sein Denken, seine Gefühlswahrnehmung, erfolgt die Wahrnehmung nicht alleine augenscheinlich, so existierte doch ein individueller Formausdruck als sein Erzeugnis. Doch entzieht sich dem nicht das Bewusstsein der Erkenntnis, ein Merkmal erkannt, ein Wesenszug ertastet, eine Stimme gehört, einen Geruch wahrgenommen zu haben. Der teilgleiche Ausdruck der Ausprägung, läge er nicht darin, als Mensch objektiv nicht, oder nicht anders wahrgenommen worden zu sein, so ist es Teil der eigenen teilgleichen Anerkennung durch den Menschen. Wodurch Bewusstsein und Geist einen Ausdruck erlangte. Erfährt der Mensch als Lebewesen die Existenz als Teilausdruck der Sinneswahrnehmung, die selbst vom Zustand der Lebendigkeit einen ursprünglichen Zustand annahm, so bliebe er physiologisch Teil dessen, dass es in einem Urzustand von seiner eigenen Entwicklung, einer eigenständiges Daseinsform gleichkomme. Seine eigene physiologische Beschaffenheit gleicht sie sich objektiv nicht in den Teilen seiner eigenen Wahrnehmung, so wird sie Teil seines eigenen natürlichen Ursprungs geblieben sein, als der Urzustand dieser Größe. Dieser Zustand, wäre er selbst nicht davon getrennt, in materiell existentieller Bedeutung. Die der Mensch in seinem Bewusstsein selbst nicht erreicht haben könnte. Der sinnesgleiche Ausdruck dieser Wahrnehmung, so bleibe er nicht für sich alleine genommen bestehen, gehörte er nicht zum Bewusstsein des Menschen. Eine Trennung eines teilgleichen Ausdrucks, im Anerkennungsmerkmal seiner individuellen Bedeutung, bemaße sich nicht daran, diese müsste veränderlich, vergänglich gewesen sein, um im Sinneszustand der Wahrnehmung erst eine Bedeutung im Bewusstsein erlangt haben zu können. Die Wahrnehmung, wäre sie nicht quantitativer Ausdruck dieses Merkmals, so gäbe es keinen Individualausdruck der Größenvariation, die ein Mensch einer Daseinsform im Sinneszustand seiner Form aufgrund seiner Erkenntnis, und Erfahrung im Leben bei misst. Dieser Ausdruck befindet sich im Menschen, im Bewusstsein, im physiologischen Teilausdruck, der körpereigener Teil über das Bewusstseinsempfinden bleibt. Und somit teilgleich in der Anerkennung eines jeden anderen Menschen. Das Merkmal der Individuation, wie es in der Formgröße alleine nicht unterschieden wäre, ist Teil der Größe, wäre ihr das Merkmal selbst nicht von alleine zugehörig. Die Ausdrucksgröße der Individualität, kann sie dem einzelnen Menschen nicht selbst angehören, oder nicht alleine Teil dessen eigener Anerkennung gewesen sein, weil sich das Bewusstsein in der Formgröße nicht davon trennte. Der Individualausdruck des Menschen wird er dadurch erst geprägt, sein Bewusstsein, seine Erscheinungsform, welche nicht ausschließlich äußerer Natur gewesen sein könnte; die kein einziger Mensch für sich alleine erfährt, weil in sich trüge. Individuell wäre der Mensch über die Zustandsgröße, die im Bewusstsein im sinnesgleichen Ausdruck des Wesenszuges nicht unterschieden gewesen sein würde. Der evolutionär biologische Ursprung, unterläge er nicht dem teilgleichen Verhältnis, dass es in der individuellen Form zwischen den Menschen nicht unterscheide, für sich individuell gewesen zu sein. Das Bewusstsein geht über diese Form nicht hinaus, in der teilgleichen Anerkennung, der eigenständigen Daseinsform. Es gehört zum Menschen und seiner Individualität, die Individualität zum Menschen, und die Seele, als Teil dieses Bewusstseins. Eine Trennung, erscheint nur möglich, für jenen, der dem Menschen seine Individualität abspricht, und sich seiner eigenen versagte. Man kann Materie erfahrungsgemäß nicht ohne Weiteres weg denken, ist ihr bestehen über das Leben des Menschen, und im Vorzeit Verhältnis als gegeben anzunehmen. Die evolutionell-biologische Entwicklung. Dies kontrastiert auch keinen unabdingbaren Widerspruch in der Formzustandsgröße, weil subjektiv wahrnehmbar, fehlten dafür im Ganzen nicht empirische Belege. Doch alleine das Denken eines materiell veranlagten, weil somit auch immer statischen, und eigentlich nicht lebensfähigen Wesen, genügt dem Widerspruch nicht, die Grundannahme der Individualität läge in einer monistischen Substanz einer individuellen Form, die aus dem nicht (teilgleichen, weil isoliert betrachteten) Materiezustand abgeleitet, weil auf einen solchen Zustand ohne Bewusstsein theoretisch zurück geführt werden könnte. Doch die Wahrnehmung, in subjektiver Hinsicht, bleibt sie nicht immer Teil dessen, selbst in der Vergänglichkeit des Lebens, dass die Materie selbst im Bewusstsein von einem Lebenszustand wieder formgleich trennte, weil der Mensch seine natürliche Aufopferung darin fand. Natürlich ist das Bewusstsein, das heraus gebildete Denken, das Wissen im Vorhandensein der Grundannahme die einfache Widerspruchslösung, in der Annahme des menschlichen Entwicklungszustand, würde er im evolutionären Teil selbst nicht fortbestehen, und im Vorfeld des Bewusstseins bestehen. Eine Trennung braucht nicht möglich, der Mensch ist das, trägt die Grundteile, die das Leben in dieser Form ermöglichten, in materieller Hinsicht in sich, und bleibt substantieller Teil seiner existentiellen Nachfolge, beim Bewusstsein selbst über den Grund der Annahme, in welcher er die Anschauung individuell auch nicht teilte, weil beinahe isoliert und für sich gesehen. Die individuelle Anschauung muss folgerichtig die Grundannahme sein, und eine Trennung bleibt selbst subjektiv nicht real, oder metaphysisch nicht widerlegbar. Leben hat Erinnerung, in mutmaßlich primitivsten Formen, eine Art von Bewusstsein, das in der Lebensfähigkeit den Individualitätsausdruck nicht widerlegte. Der Widerspruch einer materiefreien Existenz, weil individuell substantiell gesehen, vom Bewusstsein isoliert, oder unabhängig betrachtet, entspricht der Form nicht, die selbst nicht Teil ihres eigenen Ausdrucks gewesen wäre. Der Widerspruch des formellen Kriterium, dass der Mensch für sich alleine nicht als individuell anzusehen wäre, wäre es nicht Widerspruch der teilgleichen Größe; die an sich nicht isoliert betrachtet worden wäre, weil die Materie frei vom formeigenen Grundzustand, und selbst in der falschen Annahme der formeigenen Extensionalität, die jedem Einzelnen nicht vorausgegangen gewesen wäre. Doch tatsächlich entspricht sie der Annahme, das Verhältnis des Urzustandes, bliebe es davon menschlich nicht unberührt. Hier ergibt sich der Widerspruch der materiefreien Individualität, die in der Formgröße nicht teilbar, oder (in der Summe) nicht nicht unteilbar geblieben wäre, weil, sowie so existent, im relativ zeitlichen Verhältnis der Grundannahme. Folgerichtig bleibt das menschliche Bewusstsein davon nicht unberührt, im Grundzustand, der nicht dazu geführt haben würde. Frei von der Materie wäre der Übermensch, Individualität wäre substanziell nicht die eigene Gegenwart, die das Bewusstsein über ihren Ausdruck vom Urzustand für den Menschen nicht zu trennen vermag. Individualität, wäre sie nicht materiell veranlagt, aber nicht im Lebenszustand der eigenen materiellen Größe, auf elementarer Basis einer physikalischen Zustandsgröße atomarer Formvarianten, die den Lebenszustand davon nicht trennte. Folgerichtig, ergibt sich Individualität in der Anschauung, über das Bewusstsein, im jeweils anderen, das sich in der Lebensform nicht spezifizierte, oder Teil dieses Ausdrucks wäre. Die elementare Grundlage bleibt davon nicht unberührt, der Widerspruch der örtlichen Unabhängigkeit im relativen Drittverhältnis, genügt er der Annahme selbst nicht, um selbst nicht davon auszugehen, die Formverschiedenheit trüge diese Größe, die nicht eigener Teil dessen wäre. Wäre es von der Anschauung auch nicht unabhängig, die Individualität läge substantiell nicht im elementar veranlagten Teil, die den Menschen in der Form isoliert betrachtet haben würde, weil materiell nicht unabhängig, oder im Widerspruch der Annahme nicht materiefrei. Wonach Individualität das Konstrukt dieser selbst nicht relativierten Anschauung wäre, im Drittverhältnis der formgleichen Größe. Doch tatsächlich reicht die realistische Anschauung, subjektiv, das Bewusstsein trennt sich hiervon nicht, es bleibt Geistesgegenwart. Man kann sich die Frage stellen, ob die Annahme einer Substanztheorie innerhalb der Individualität zufällig sein könnte, unter der Voraussetzung einer individuellen Anschauung, im Verhältnis, respektive Drittverhältnis der relativen Deutung, und ein Mensch für sich nicht als individuell anzusehen wäre, oder die folgerichtige Tatsache jede andere Annahme untermauerte. Die Frage nach dem Leben, bedeutet sie nicht mehr als die Frage nach dem Menschen, weil es naturgemäß nicht beansprucht worden wäre, selbst in bedingter Formgleichheit eines formellen Kriterium, als die Individualität des Menschen, mag jede Täuschung so groß, die Begeisterung so groß gewesen sein, dass es der Voraussetzung selbst nicht weiter genügte, als nicht gelebt zu haben. Wäre Individualität selbst nicht durch den Menschen bestimmt, der nicht anders ausdrucksfähig gewesen wäre, auch ohne den Menschen, bliebe naturgemäß, substantiell gesehen Individualität bestehen, die also zur Antithese des Ausdrucks führte, dem sich eine menschliche Anschauung nicht bediente, weil existenziell, materiell gesehen. Wonach die Annahme falsch gewesen wäre, oder substantiell falsch gewesen sein müsste, um selbst nicht vom Gegenteil auszugehen, über die substanzielle Individualität bilde sich jeder Teilausdruck, innerhalb der menschlichen Wahrnehmung. Und es müsste zum Gegensatz geführt haben dürfen, den Menschen individuell-substantiell als isoliert anzusehen. Eine einfache Wahrheit, die sich dem Grund nach so nicht widerlegte, weil es existenziell bestimmt worden wäre. Denn selbst wenn das Bewusstsein nicht ausgeprägt wäre, müsste Individualität also substantiell, oder von einem einzelnen Menschen nicht verschieden, gegenwärtig oder zumindest seine eigene Einzigartigkeit gegeben sein, wie der Mensch es also wäre. Denn Formgleich ist der Ausdruck nicht in der Teilgröße, menschliche Individualität existiert also nicht ohne jeden anderen, der selbst nicht gleich gewesen wäre. Wahrlich zeichnet Individualität den Menschen aus, als Paradoxon der Widerspruchsweise, in der Menge scheint der einzelne Mensch mutmaßlich klein, und gleich, in seiner individuellen Bedeutung, die Kraft die zum Ausdruck kommen kann. Wahrlich soll Individualität den Menschen auszeichnen, als Paradoxon der Widerspruchsweise, in der Masse, im Ganzen scheint der einzelne Mensch mutmaßlich klein, und objektiv gleich, in seiner individuellen Bedeutung, findet man im einfachsten Ausdruck dieser Anerkennung, nicht seine eigene individuelle Ausdrucksweise, als soziale Anerkennung, weil im Menschsein. Die Kraft, die zum Ausdruck kommen kann, in der Anerkenntnis des Menschlichen, dem sich der andere Teil selbst nicht widerspricht, und auf die Zukunftsfragen zurückzuführen wäre. Subjektiv scheint die Welt groß, in der örtlichen Unabhängigkeit der individuellen Bedeutung, läge in der Ferne nicht die Nähe, in der Anerkenntnis der Individualität nicht die Liebe, als die Schönheit des Lebens |
| ↑3 | “Die Gleichnis existenzieller Gegenwart – Und Dasselbe eines existentiell Gegenständlichen” |