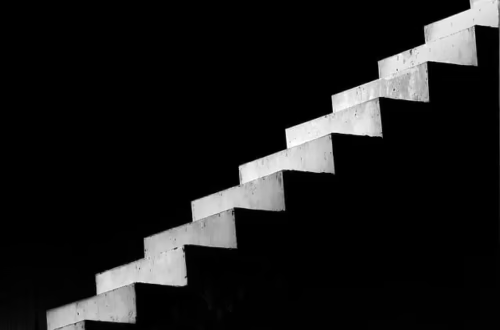Eine teilgleiche Größe – Und die Ordinalität des formellen Kriteriums
Im Sinne der formeigenen Deutungsmöglichkeit, wäre die Unendlichkeitsmöglichkeit im teilgleichen Größenverhältnis innerhalb einer eigenen objektiven Ordnung, teilgleich ihrer relativen Teile.
Unter den objektiven Bedingungen des relativen Gegensatzprinzips, wäre eine teilgleiche Größe also objektive Äquivalenzform der Eindeutigkeit, bei prinzipiell unendlich vielen relativen Unteilbarkeiten, auf die sich das absolute Kriterium im Bedeutungswert des formellen Kriteriums[1]Vgl. “Die Individualität – Die Individualität des Menschen” als stetig im Bilde einer eigenen Form, also als die Unteilbarkeitsform heraus bilden ließe, gleich wie sich eine individuelle Anschauung darauf verhielte, bei allen relativ geteilten, oder zusammengeführten Größen, innerhalb einer objektiven Ordnungsstruktur.
Bei allem, jedoch unter der Voraussetzung gesehen, dass materiell gesehen eine eindeutige Unteilbarkeit; wäre sie nicht eigener Bedeutungswert der Eindeutigkeit, für sich genommen unwahrscheinlich sein dürfte. Weil unteilbar wäre Existenz, dass es sei, materiefrei, statisch, im Verhältnis eines Energiezustand, über die Bedingungen von realen Lebensform der Daseinswelt hinaus gesehen[2]Es geht auf subjektive Erfahrungen zurück, auf subjektive Wahrnehmung, weil sich ein Gegenstand durch Menschenhand “teilen” ließe; materiefrei, wäre energiefrei, statisch über … Continue reading.
Dürfte es nicht so verhalten, jedenfalls auf einen geistigen Zustandswert einer idealisierten Größe verstanden werden. Der sich als überdimensionale Größe eines selbst surrealen Zustandsbildes, bei eigentlich kaum fassbaren Größen im Individualitätsausdruck daran bemisst; bei relativen, aber im Geiste nicht unerreichbaren Größen der Unendlichkeitsmöglichkeiten, als relative Unteilbarkeitsformen eines Daseins, dass es so einem objektiv realen Zustandswert entspricht.
Denn grenzwertig wäre zu keinem Zeitpunkt nicht die Eindeutigkeit; es wäre unendliche Größe des Ausdrucks, an dem sich der Bedeutungswert im Einzelnen nicht vergleichen ließe, bei unendlich gleich bleibenden Größen, bei eigentlich relativ gleich bleibenden Teilen einer eigenen Anschauung, innerhalb einer eigenen subjektiven Wahrnehmung.
Egal wie sich das Merkmal des Wesenszuges unterscheide, wäre es nicht absoluter Gegensatz darin; es wäre der absolute Gegensatz eines einheitlichen Äquivalent der teilgleichen Größe, dass es darin subjektiver Zustandswert des ganzheitlichen Wesensbildes bleiben würde, an dem sich eine Einheitsstruktur relativ im Verhältnis ihrer einzelnen Teile bedeuten lassen ließe.
Die sich als Äquivalent der Gegenwart, darin einander aufteilte, doch das Äquivalent, wäre es nicht Teil der Größe; die in der relativen Summe die Unendlichkeit dadurch erst erlangte, anderer Teil, als nicht unendlich gleich, und nicht unendlich groß, weil nicht unendlich gleich groß im eigentlichen Teil geblieben zu sein; an denen sich das Äquivalent der Größe selber nicht bemaße; die selbst auch nicht Teilgröße des formeigenen Ausdrucks geblieben wäre.
Sie wäre die strukturelle Form des teilgleichen Äquivalent, eines formeigenen Ausdrucks innerhalb von Zustandsgrößen, der relativen Einheitsform. Die Eindeutigkeit, erscheint sie hier nicht als das relative Komplement; die sich also um jeden anderen Teil, der von selbst nicht nicht unteilbar in der Form, weil selbst an sich im Gegensatz nicht individuell erschienen wäre, im relativen Selbstbild des relativen Gegensatzes stetig ergänzte.
Das relative Teilungsverhältnis, welches über die materielle Begebenheit; die in der Gänze, nicht das Seiende gewesen wäre, weil Sein sich zeitlich davon differenzierte; weil nicht Gegensatz der eigenen Anschauung gewesen wäre; weil formgleich wäre die Anerkennung der Größe nicht relativ teilgroß, keiner eigenen Bedeutung, und keines eigenen Zustandswertes.
Denn als eigener Teil des Zustandes oder des eigentlichen Bedeutungswertes würde die objektive Größe zweideutig, in der Extensionalität des relativen Ausdrucks, auf die sich das Teilungsverhältnis an und für sich nicht weiter reduzieren ließe, um eindeutig im Bilde eines eigenständigen Ausdrucks geblieben zu sein.
Dadurch bildet sich innerhalb einer eigenen subjektiven Anschauung eine eigene Ordnung, worin sich objektiv die Ordinalität einzelner Wesenszüge im Teil formgleich deuten ließ, wenngleich diese in Einzelnen, oder in einer gegebenen Eindeutigkeit nicht relativ zueinander zu sehen wären.
References
| ↑1 | Vgl. “Die Individualität – Die Individualität des Menschen” |
|---|---|
| ↑2 | Es geht auf subjektive Erfahrungen zurück, auf subjektive Wahrnehmung, weil sich ein Gegenstand durch Menschenhand “teilen” ließe; materiefrei, wäre energiefrei, statisch über erfahrbare Zustandsgrößen hinaus, Leben dürfte nicht möglich; objektiv erhält sich die Natur, jene Unteilbarkeit, wäre es nicht eine Vorstellung einer eigenen menschlichen Zerstörungsform von natürlicher Existenz, welche sich am selbst bedingten Zustand bemessen, nicht wieder herstellen ließe, je nachdem wie weit diese Zerstörung nach den eigenen, wenn nicht tatsächlichen Vorstellung reichen dürfte, also realitätsgetreu gesehen. Es bezieht sich also auf den Formausdruck eines damit verbundenen Wesenswert, der geistlich im Willen, der Selbsttäuschung, unweigerlich miteinander verbunden sein sollte. Es erscheint unter diesen Voraussetzungen auch legitim, über den Bedeutungswert, der sich so erhalten ließe, mag es eigentlich auch noch so falsch gewesen sein, es bleibt an einem geistlichen, und metaphysischen Zustandswert bemessen. Der Mensch will in seiner Vergänglichkeit nicht wahrhaben, das Zustände sich scheinbar unendlich erhalten können, und kein Teil unbedingt abschließend größer, oder kleinerer Bedeutungswert, selbst im materiellen Sinne gewesen sein müsste, sondern, die Existenz in der Dynamik des allumfassenden Lebens besteht, in Wirkungsweisen, die sogar größenunabhängig gewesen sein dürften |