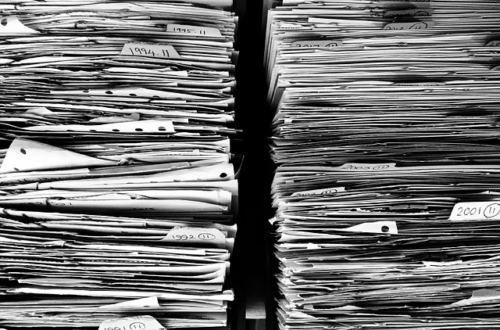Das Relative Gegensatzprinzip – Methodik in relativen Gegensätzen
Das Relative Gegensatzprinzip besagt in vereinfachter, und dadurch verhältnismäßig vorausgesetzter Annahme, prinzipiell, dass jedes Phänomen im Verhältnis zu einem Gegenpol verständlich wird. Die darauf beruhende Erkenntnis entsteht durch Kontrast, nicht durch Isolation eines Merkmals, eines auftretenden Phänomens. Weil schon die Unterscheidungsgrundlage, in der Voraussetzung fehlen würde. Es ist somit unweigerlich an das angenommene Vorhandensein, streng genommen sogar an den Existenzbegriff, den Seinszustand im Dasein selbst geknüpft.
Es beruht auf Wechselwirkungen, worin das resumptierende Attribut[1]Vgl. Die Gleichnis existenzieller Gegenwart – Und Dasselbe eines existentiell Gegenständlichen gemäß der Interpretationsmöglichkeit, oder eigentlichen Annahmevoraussetzung also entsprechend zum Ausdruck kommen kann. Der Kontrast ist immer auch Grenzraum der Interpretation, an dem sich die Vorstellungen wahrnehmungsbezogen bemisst.
Unter der Voraussetzung des Individualitätsausdruck, bestätigt sich die Annahme in der Voraussetzung, die in der Verneinung, oder in einer absoluten Bejahung zur Geltung kommt. Die Interpretation erfolgt unter Einbeziehung von subjektiven Erfahrungswerten. Einzelne Unterschiede dürfen unter kollektiven Annahmen nicht unberücksichtigt bleiben, wenngleich sie realitätsbezogen eigentlich gleich bedeutender Teil des Ganzen wären.
Ein konzeptionelles Methodenmodell erfolgt unter Berücksichtigung der Teilaspekte, unter der Annahme, dass es in der Zustandsbeschreibung selbst implizierte Berücksichtigung erfährt. Es definiert sich als innere Kohärenz der Merkmalsfolgen, im Verhältnis dazu, diese gedeutet zu haben, wenngleich diese Deutung unendlich oft möglich sein dürfte[2]Vgl. Das relative Gegensatzprinzip – Und das Unendlichkeitsverhältnis individueller Deutungsmöglichkeiten.
Es soll eine ganzheitliche Analyse ermöglichen, um Zustandsbilder, auf menschliche Handlungen bezogene Phänomene, zu interpretieren. Dabei beruht ein qualitativer Ausdruck einer Entscheidung auf einem relativen Nicht-Vorhandensein, in der darauf beruhenden, implizierten Gegenannahme, in der Ausprägung eines Merkmals, eines Phänomen, dass es selbst dem Wirken, einer Leistung entsprochen haben dürfte. Die Erkenntnis wird gewonnen durch Kontraste, nicht isolierter Merkmale.
Im Kern enthält jede Antithese den Keim ihrer These, und umgekehrt. Die Grundsätze können in einer vereinfachten, intersubjektiven Annahme eines Zustandsbildes dazu dienen, um Leitfäden herauszustellen, Spannungsfelder zu durchdringen, und praxisnah Lösungsansätze zu entwickeln.
Die Implementierung erfolgt auf Gegenüberstellung des jeweils anderen Merkmals, respektive Phänomen, wozu sich ergebnisorientiert bekannten analytischen Formulierungen, wie einem Matrixmodell bedient werden kann.
| Phänomen/Gegenpol | Determinismus | Nicht-Vorhandensein | Kollektivität | Objektivität |
| Freiheit | Überwindung innerer Grenzen der Entfaltung | Definition: Nicht-Vorhandensein von inneren Grenzen | Kein spezifisches Gruppen oder Massenverhalten | Erkenntnis im subjektiven Erleben |
| Vorhandensein | Entfaltungsmöglichkeiten über den Ursachengrund | Bedeutung durch das implizierte Gegenteil der Annahme | Manifestation im Einzelnen ohne Verlust im Ganzen | Objektive Realität |
| Individualität | Einzigartigkeit über subjektive Einflüsse hinaus | Definition über den Verlust im Ganzen | Keine Abweichung innerhalb falschen Normen | Ausdruck in subjektiver Wahrnehmung; objektiv deutsam |
| Subjektivität | Dynamisch gegenüber determinierten Grenzen | Abgrenzung von der eingeschränkten Deutung | Kontraste sozialer Rollenverhältnisse | Abgleich über Bestimmbarkeit |
Jedes Merkmal, Phänomen tritt im relativ zueinander vorhandenen, respektive angenommenen Gegenpol auf.
Daraus kann eine Matrix relativ relationaler Definition aufgestellt werden.
| Phänomen | Gegenpol 1 | Gegenpol 2 | Definition |
| Freiheit | Determinisums | Grenzen | Freiheit ist das Maß an selbstbestimmte Handlungen im Verhältnis zu Grenzen und Vorherbestimmung |
| Subjektivität | Entfernung | Isolation | Subjektivität entsteht durch wechselseitige Bindung, Entfernung und Isolation das Gegenteil |
| Stagnation | Veränderung | Chaos | Bestimmte Strukturen unter Begrenzung von Abweichungen |
| Individualität | Kollektivität | Normierung | Individualität; Überwindung von Grenzen und Vorherbestimmung |
Jedes Phänomen wird im “Nicht-Vorhandensein” an einem oder mehreren Polen gegenübergestellt. Die relationale Definition verknüpft das Phänomen mit seinen relativen Gegensätzen.
Grafentheoretischen Modellbildung[3]Diskrete Strukturen Band 1: Kombinatorik, Graphentheorie, Algebra, 2. Auflage, Springer von Angelika Steger: Die Matrix relativer Gegensätze kann gewichtet, in eine Adjazenzmatrix umgewandelt werden, die sich also an numerischen Intensitäten bemessen lässt, beispielsweise in einem Intervall [0,1].
| Konzeption | Gegenannahme | Intensität |
| Freiheit | Determinismus | 0.8 |
| Subjektivität | Entfernung | 0.6 |
| Stagnation | Veränderung | 0.9 |
| Individualität | Kollektivität | 0.7 |
Die Adjazenzmatrix soll somit die Beziehungen zwischen den Phänomenen als gerichtete oder ungerichtete Kanten darstellen.
Es sei:
- Ein hoher Intensitätswert (≈1) zeigt eine starke Ausprägung des Phänomens.
- Ein niedriger Intensitätswert (≈0) zeigt eine starke Ausprägung des Gegenpols.
- Die Differenz oder relative Ähnlichkeit zwischen Phänomenen kann als Verbindung(Kante) interpretiert werden.
Adjazenz- und Ähnlichkeitsdefinition
Sei \(G=(g_i)_{i=1}^n\) ein Vektor mit Merkmalswerten \(g_i \in [0,1]\).
Die gewichtete Adjazenzmatrix \(A=(a_{ij})\) wird definiert durch
\(a_{ij} = 1 – |g_i – g_j| \quad \text{für } i,j=1,\dots,n.\)
Zur Binarisierung kann ein Schwellenwert \(\theta\) verwendet werden:
\(\tilde a_{ij} =\)
- \(1 \quad \text{falls } a_{ij}>\theta\),
- \(0 \quad \text{sonst}\)
Regressionsmodell zur Gewichtung von Knotenrelevanz
Lineare Ausgleichsstrategie für signifikante Knotenpunkte: In relationalen Begriffssystemen, etwa bei der Anwendung des Relativen Gegensatzprinzips, treten bestimmte Konzepte als besonders konfliktbeladen, oder diskursprägend hervor. Um diese systematisch zu analysieren bietet sich beispielsweise eine lineare Ausgleichsstrategie an.
Die Methode zielt darauf ab, die Problemrelevanz einzelner Knotenpunkte (z. B. Freiheit, Individualität) im Verhältnis zu ihren strukturellen Eigenschaften zu modellieren. So lassen sich gezielte Interventionen ableiten lassen, etwa zur Konfliktminderung, oder zur Förderung von Kohärenz.
Die Strategie basiert auf einem linearen Regressionsmodell[4]Vgl. Wolfgang Kohn, Riza Öztürk Statistik für Ökonomen, 2., überarbeitete Auflage, Kapitel. 17:
\(y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{k} \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i,\)
wobei gilt: \(y_i\): Problemrelevanz des Knotenpunkts, \(x_{ij}\): Merkmale (z.,B. Degree, Betweenness)
\(\beta_j\): Einflusskoeffizienten
\(\varepsilon_i\): Residuen
Positive Koeffizienten (\(\beta_j > 0\)) verstärken die Problemrelevanz, negative Koeffizienten (\(\beta_j < 0\)) mindern sie.
Für die Parameterschätzung gilt:\(\hat\beta = (X^\top X)^{-1} X^\top y.\)
Die Residuenvarianz kann geschätzt werden mit
\(\hat\sigma^2 = \tfrac{1}{n-k-1} \sum_{i=1}^n \hat\varepsilon_i^2.\)
Zur besseren Vergleichbarkeit der Koeffizienten empfiehlt sich die Standardisierung: \(\tilde x_{ij} = \frac{x_{ij} – \bar x_j}{s_j},\) wobei \(\bar x_j\) der Mittelwert und \(s_j\) die Standardabweichung des Merkmals \(j\) sind.
Das Prinzip lässt sich analytisch beliebig weiter ausführen, innerhalb der Netzwerkanalyse, einer dynamischen Analyse, innerhalb von Zeitreihen. Es kann in der Organisationsentwicklung angewendet werden, beispielsweise um festzustellen, wie sich Freiheit und Regulierung in Gruppen verhalten, in der Psychologischen Diagnostik, bei der Erfassung von Nähe-Distanz-Dynamiken, Stagnation, und Veränderungen.
References
| ↑1 | Vgl. Die Gleichnis existenzieller Gegenwart – Und Dasselbe eines existentiell Gegenständlichen |
|---|---|
| ↑2 | Vgl. Das relative Gegensatzprinzip – Und das Unendlichkeitsverhältnis individueller Deutungsmöglichkeiten |
| ↑3 | Diskrete Strukturen Band 1: Kombinatorik, Graphentheorie, Algebra, 2. Auflage, Springer von Angelika Steger |
| ↑4 | Vgl. Wolfgang Kohn, Riza Öztürk Statistik für Ökonomen, 2., überarbeitete Auflage, Kapitel. 17 |