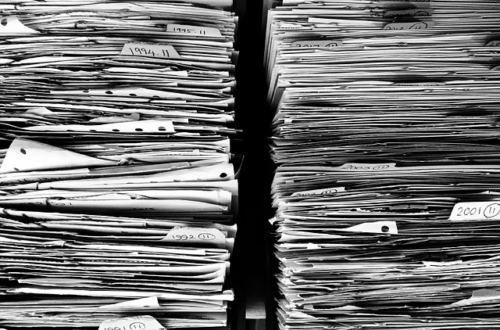Fristdeformation – Und allgemeine Erwartungsleistung
Definition: Unter Fristdeformation verstehen wir die Abweichung einer tatsächlich zur Verfügung stehenden oder genutzten Zeitspanne von der normativ vorgesehenen Sollfrist. Sie beschreibt damit die zeitliche Verzerrung, die sowohl in Richtung einer Verkürzung (Säumnis, Zeitdruck) als auch einer Verlängerung (Aufschub, Verzögerung) auftreten kann.
Es sei;
\(
\Delta T_i = Z_i – T_i,
\)
- \(Z_i\): normativ vorgesehene Sollfrist für Handlung oder Erfüllung,
- \(T_i\): tatsächlich realisierte oder verbleibende Frist,
- \(\Delta T_i\): Fristdeformation.
Vorzeichen;
- \(\Delta T_i > 0\): Verlängerung der Frist, d.,h. zusätzliche Zeit gegenüber der Norm (Aufschub).
- \(\Delta T_i = 0\): Konvergenzpunkt, Soll- und Istfrist stimmen überein.
- \(\Delta T_i < 0\): Verkürzung der Frist, d.,h. Säumnis oder Zeitdruck.
Die Fristdeformation ist ein relatives Maß, das unabhängig von der absoluten Länge der Sollfrist interpretiert werden kann. Sie wirkt als zeitlicher Faktor in allen Modellen der Leistungserwartung und Schuldverhältnisse, kann sowohl deterministisch (z.,B. durch feste Fristverkürzung) als auch stochastisch (z.,B. durch zufällige Verzögerungen) modelliert werden.
Bedeutung im Kontext: Die Fristdeformation ist ein zentrales Bindeglied zwischen objektiver Handlungsfähigkeit und objektivem Wertvergleich:
- Bei negativer Fristdeformation steigt das Mehrleistungserfordernis, um die Sollwerte dennoch zu erreichen.
- Bei positiver Fristdeformation sinkt der unmittelbare Druck, allerdings kann strukturelle Verschleppung eintreten.
- Am Konvergenzpunkt \(T=0\) lassen sich alle Schuldverhältnisse vergleichend auf einen gemeinsamen Zeitwert abbilden.
Übergang zur Allgemeinen Erwartungsleistung
Erwartungslogik: Die eingeführte Fristdeformation \(\Delta T_i\) beschreibt die zeitliche Abweichung zwischen Soll- und Istfrist. Sie wirkt als zentraler Faktor, der die objektive Handlungsfähigkeit \(H_i(t)\) und den objektiven Wertvergleich \(V_i(t)\) beeinflusst.
Damit bildet sie die Brücke zur Allgemeinen Erwartungsleistung (AEL), die als übergeordnete Größe die normativ geforderte Leistung unter Berücksichtigung von Zeit, Wert und Handlungskapazität beschreibt.
Mit der Definition der Allgemeinen Erwartungsleistung einer Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\);
\(
\mathrm{AEL}_i(t) \;=\; H_i(t) \cdot V_i(t) \cdot \varphi \left(\Delta T_i(t)\right),
\)
mit \(H_i(t)\): objektive Handlungsfähigkeit, \(V_i(t)\): objektiver Wertvergleich, \(\varphi(\Delta T_i)\): Zeitfaktor, der die Fristdeformation abbildet[1]Siehe: Nutzwert-Analysen (Multi-Criteria Decision Making, MCDA); Leitfaden zur Anwendung von Methoden der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung – Methode: PROMETHEE, Lehrstuhl für … Continue reading.
Zeitfaktor als Deformationsfunktion: Der Zeitfaktor \(\varphi(\Delta T_i)\) kann allgemein als monoton fallende Funktion modelliert werden[2]Siehe auch: Endogene Zeitdiskontierung; “Eine Theorie endogener Zeitdiskontierung“ von Bruno S. Frey und Hans Jürgen Ramser (1974) in der Zeitschrift für Wirtschafts- und … Continue reading:
\(
\varphi(\Delta T_i) = \frac{1}{1 + \alpha \cdot |\Delta T_i|^\beta},
\)
mit \(\alpha,\beta > 0\).
Damit gelte;
- \(\Delta T_i = 0 \;\Rightarrow\; \varphi(0) = 1\) (keine Verzerrung),
- \(\Delta T_i < 0 \;\Rightarrow\; \varphi(\Delta T_i) < 1\) (Säumnis, Mehrleistungserfordernis)
- \(\Delta T_i > 0 \;\Rightarrow\; \varphi(\Delta T_i) < 1\) (Verzögerung, strukturelle Verschleppung)
Die Allgemeine Erwartungsleistung \(\mathrm{AEL}_i(t)\) ist damit ein integratives Maß. Es berücksichtigt die Kapazität (Handlungsfähigkeit), den Wertbezug (objektiver Vergleich von Ist- und Sollwert), sowie die zeitliche Dimension (Fristdeformation).
Ein Wert \(\mathrm{AEL}_i(t) \approx 1\) bedeutet, dass die normativen Erwartungen erfüllt sind. Werte \(\mathrm{AEL}_i(t) < 1\) zeigen Untererfüllung, während \(\mathrm{AEL}_i(t) > 1\) auf Übererfüllung hinweisen.
Die AEL stellt den logischen Übergang von der isolierten Betrachtung einzelner Faktoren (Zeit, Wert, Kapazität) zu einem ganzheitlichen Erwartungsmaß dar. Sie erlaubt es, Schuldverhältnisse, Leistungspflichten und Fristlagen auf einer gemeinsamen Skala zu vergleichen und bildet damit die Grundlage für eine objektive Bewertung im rechtlich-ökonomischen Kontext.
Erhaltungswerte
Die Erhaltungswerte einer Geschäftseinheit oder Person stellen die objektive Grundlage für Handlungsfähigkeit dar. Im Kontext wirtschaftlicher Verluste und staatlicher Schuldanteile müssen diese Werte nicht nur materiell erhalten bleiben, sondern auch zeitlich angepasst werden.
Zur weiterführenden Betrachtung sei Ziel, die notwendige Fristverkürzung zu bestimmen, die erforderlich ist, um in der Handlungsfähigkeit einem negativen Verlustwert gerecht zu werden, und die Funktionsfähigkeit zu sichern.
Mit den Größendefinitionen;
- \(E_i(t)\): Erhaltungswert der Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\) \( \rightarrow \) Mindestwert zur Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit
- \(V_i(t)\): Verlustwert der Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\) \( \rightarrow\) wirtschaftlicher Schaden oder Substanzminderung
- \(Z_i(t)\): Soll-Dauer der Handlung oder Frist (z.\,B. Zahlungsziel, Lieferfrist)
- \(T_i(t)\): tatsächlich verfügbare Dauer unter Verlustbedingungen
- \(\Delta T_i(t) = Z_i(t) – T_i(t)\): Zeitdifferenz, die durch Anpassung entsteht
- \(A_i(t)\): Anpassungsbedarf zur Kompensation des Verlusts
seien;
- \( E_i(t) \ge V_i(t) + A_i(t) \) \(\rightarrow\) Erhaltungsbedingung
- \( \Delta T_i(t) = Z_i(t) – T_i(t), \quad \text{wenn } E_i(t) < \theta_E \) \(\rightarrow\) Zeitdifferenz
- \( A_i(t) = \gamma \cdot \Delta T_i(t) + \delta \cdot V_i(t) \) \(\rightarrow\) Anpassungsbedarf
und;
- \(\theta_E\): Mindestschwelle für Erhaltungswert
- \(\gamma, \delta\): Gewichtungsfaktoren für Zeit und Verlust
Interpretation: Die Anpassungsbedingung, respektive die Erhaltungsbedingung zeigt, dass der Erhaltungswert \(E_i(t)\) nicht nur den Verlustwert \(V_i(t)\) decken muss, sondern auch den zeitlich bedingten Anpassungsbedarf \(A_i(t)\). Die Zeitdifferenz \(\Delta T_i(t)\) (vgl. Gleichung Zeitdifferenz) entsteht, wenn die verfügbare Frist \(T_i(t)\) unter der Soll-Dauer \(Z_i(t)\) liegt. Je größer der Verlustwert und je kürzer die verfügbare Zeit, desto höher ist der Anpassungsbedarf. Dies erlaubt eine objektive Bewertung, wann Fristen als verkürzt gelten müssen, um dem negativen Wert gerecht zu werden.
Umgekehrte Fristlogik
Die Fristverkürzung beschreibt den relativen Verlust an verfügbarer Zeit im Verhältnis zur ursprünglich vorgesehenen Soll-Dauer. Im Kontext wirtschaftlicher Verluste und Erhaltungswerte ist es entscheidend, diesen relativen Zeitverlust zu quantifizieren, um den daraus resultierenden Anpassungsbedarf zu bestimmen.
Neben den bereits eingeführten Größen sei;
- \(R_i(t) = \frac{T_i(t)}{Z_i(t)}\): reales Fristverhältnis (1 = volle Soll-Frist, \(<1\) = verkürzt)
- \(\kappa_i(t) = 1 – R_i(t)\): relative Fristverkürzung in Anteilen der Soll-Dauer
Dann sei;
- \( R_{i} \left(t\right) = \frac{ T_{i} \left( t \right) }{Z_{i} \left(t\right)} \)
- \( \kappa_i(t) = 1 – R_i(t) \)
- \( A_i(t) = \gamma \cdot \kappa_i(t) \cdot Z_i(t) + \delta \cdot V_i(t) \)
mit \( \gamma\): Gewichtungsfaktor für den Zeitanteil, und \( \delta\): Gewichtungsfaktor für den Verlustanteil
Interpretation: \(R_i(t)\) zeigt, wie groß der Anteil der Soll-Frist tatsächlich zur Verfügung steht, \(\kappa_i(t)\) gibt an, um wie viel Prozent die Frist verkürzt ist. Ein hoher Wert von \(\kappa_i(t)\) bedeutet, dass die Handlungsspielräume stark eingeschränkt sind und der zeitbedingte Anteil am Anpassungsbedarf steigt.
Mit der relative Fristverkürzung:
\( \kappa_i(t) = 1 – \frac{T_i(t)}{Z_i(t)} \)
erhalten wir den Verlustwert steigend mit Fristverkürzung:
\( V_i(t) = \frac{A_i(t) + \gamma \cdot \kappa_i(t) \cdot Z_i(t)}{\delta} \)
Fristdeformation durch fehlerhafte Entscheidungen
In der Realität können prozessuale Fristen durch justizielle Fehlentscheidungen entweder ins Unendliche (Keine zeitgemäße Erledigung, Verlust von Beweisen, Zeugenaussagen werden hinfällig, Sache kann nicht mehr erledigt werden) verlängert oder faktisch auf null verkürzt werden (Der daran geknüpfte Schadenseintritt ist unmittelbar, steht in direkter Verbindung dazu).
Wir modellieren dies über zwei Indikatoren pro Verfahren \(i\):
- \(\delta^+_i \in \{0,1\}\) signalisiert eine schwerwiegende Verfahrensunterlassung
- \(\delta^-_i \in \{0,1\}\) signalisiert eine unberechtigte Vorwegnahme des Entscheids mit irreversiblen Folgen (z.B. Insolvenz)
Dann sei die „deformierte“ Verfahrensfrist
\(D_i = \)
- \(\infty, \delta^+_i = 1, \)
- \(0, \delta^-_i = 1, \)
- \(T_i, \delta^+_i = \delta^-_i = 0 \)
wobei \(T_i \leq T_{\max}\) die reguläre Frist (gemäß ZPO/StPO) ist.
Aggregierte Fristdeformation
Definiere die durchschnittliche Fristdeformation \(D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i.\)
Bei sich überlagerten Fällen, als Anhäufung
\(V_J > V_{\max}\) und positiver Fehlerquote \(\pi^+ = \frac{1}{n} \sum_i \delta^+_i, \quad \pi^- = \frac{1}{n} \sum_i \delta^-_i,\)
ergibt sich
\(D = \pi^+ \cdot \infty + \pi^- \cdot 0 + (1 – \pi^+ – \pi^-) T.\)
Damit gilt: \(D = \infty \quad \text{falls } \pi^+ > 0,\) \(D = 0 \quad \text{falls } \pi^- > 0.\)
In beiden Fällen steht \(D\) im Widerspruch zum verfassungsrechtlichen Gebot der gebührenden Verfahrensdauer (Art. 6 EMRK, § 143 ZPO), das \(0 < D_i \leq T_{\max}\) fordert.
Formulierung als Funktion der Rechtsverletzungsintensität: Ersetzen wir die Indikatoren durch Fehlerintensitäten \(\delta^\pm_i \geq 0\) und eine glatte Deformationsfunktion \(h(\delta^-_i, \delta^+_i) = \frac{1 + \alpha^- \delta^-_i}{1 – \alpha^+ \delta^+_i},\quad \alpha^\pm > 0,\)
so gilt \(D_i = T_i \, h(\delta^-_i, \delta^+_i).\)
Für \(\delta^+_i \to 1\) und wachsendes \(\alpha^+\) nähert sich \(D_i \to \infty\), für \(\delta^-_i \to \infty\) nähert sich \(D_i \to 0\). Jede systematische Fehlentscheidung (\(\mathbb{E}[\delta^\pm_i] > 0\)) zieht eine unendliche oder verschwindende mittlere Frist \(\mathbb{E}[D_i] \notin (0, T_{\max}]\) nach sich und verletzt das Prinzip der gebührenden Verfahrensdauer.
Zeitinvarianz und Fristendifferenzen
Neben den normativen Widersprüchen aus zeigt sich ein weiterer Bruch mit prozessualen Grundsätzen: Die beobachtete stationäre Verfahrensanhäufung ist zeitausgleichsinvariant, obwohl Einzelfälle in der Regel innerhalb gesetzlicher Fristen erledigt werden müssen.
Modell der Zeitentwicklung: Sei \(V_J(t)\) die mittlere Zahl offener Verfahren zum Zeitpunkt \(t\). Im allgemeinen \(M/M/1\)– bzw. \(M/M/c\)–Modell[3]Siehe: Queuing-Warteschlangenabbildung; Warteschlangen von Christian Dombacher (1994) gilt
\(\frac{\mathrm{d}V_J}{\mathrm{d}t}\)
\(= \lambda_J(t)\;-\;\mu_J(t)\;+\;\underbrace{\bigl(\mu_J(t)-c\mu\bigr)^+ P_W(t)}_{\text{Queueing–Zulauf}}\)
wobei \(P_W(t)\) die Erlang-C–Wartewahrscheinlichkeit ist.
Für eine stationäre Anhäufung verlangt das Modell
\(\frac{\mathrm{d}V_J}{\mathrm{d}t} ;=; 0\)\( \Longrightarrow \)\( \lambda_J = c\,\mu_J \quad\text{sowie}\quad P_W\,\bigl(\mu_J – c\mu\bigr)^+ = 0. \)
Dies impliziert eine perfekte Balance von Ankunfts- und Bearbeitungsraten zu jedem Zeitpunkt.
Reale Verfahren unterliegen Fristen nach ZPO, StPO etc. (z.,B. §§ 147, 156 StPO). Für jede Akte \(i\) existiert eine Bearbeitungszeit \(T_i\) mit Verteilungsfunktion \(F_{T_i}(t)\) und einer Obergrenze \(T_{\max}\).
Es gilt:
\( \Pr\bigl\{T_i \le T_{\max}\bigr\} = 1 – \varepsilon, \quad \varepsilon \ll 1. \)
Trotz dieser Fristdifferenzen zeigen die empirischen \(V_J(t)\) über lange Perioden keine saisonale oder zufällige Schwankung – \(V_J(t)\) bleibt konstant. Das widerspricht jeder Erklärung durch Alltagsbearbeitung, in der \( T_i > 0 \Longrightarrow V_J(t) > 0\).
Art. 6 EMRK und § 143 ZPO garantieren das Recht auf „Gebührende Verfahrensdauer“. Eine perfekte Zeitinvarianz \(V_J(t)\equiv\text{const.}>V_{\max}\) impliziert systematische Überschreitung aller Fristen und damit einen kollektiven Verstoß gegen das Verbot „unverhältnismäßiger Verfahrensdauer“.
Die Kombination aus stationärer Verfahrensanhäufung \(\mathrm{d}V_J/\mathrm{d}t=0\), und positiven Fristendifferenzen \(T_i>0\) ist nur durch eine strukturelle Missachtung prozessualer Fristen und fairer Einzelfallbearbeitung erklärbar. Zeitinvarianz der Verfahren steht im direkten Widerspruch zu den verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben zur zügigen Verfahrensführung.
Dynamische Schwellenanpassung bei Fristenbeibehaltung
Die Beibehaltung von Fristen unter Rückgang objektiver Liquidität erfordert eine dynamische Bewertung. Die bisherige statische Schwelle \(\theta_O\) zur Entscheidung über Friststabilität muss erweitert werden, da externe Faktoren wie Segmenttyp, Liquiditätsvolatilität und systemischer Druck die Tragfähigkeit einer Frist beeinflussen. Ziel dieser Erweiterung ist es, eine dynamische Schwellenfunktion \(\theta_O(t)\) zu definieren, die kontextabhängig angepasst wird.
- \(F_i(t)\): objektive Fristdauer der Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\)
- \(L_i(t)\): Liquidität der Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\)
- \(R_i(t) = L_i(t-1) – L_i(t)\): Rückgang der Liquidität
- \(O_i(t) = \frac{F_i(t)}{R_i(t)}\): Überlagerungswert
- \(\theta_O(t)\): dynamische Schwelle zur Fristbeibehaltung
- \(V_i(t)\): Volatilität der Liquidität (z.,B. Standardabweichung über Zeitfenster)
- \(D_{\text{sys}}(t)\): systemischer Druck (aggregierter Belastungsindikator)
- \(S_i\): Segmenttyp (numerisch kodiert, z.,B. Verwaltung = 1.0, Produktion = 0.6)
Es sei;
\( \theta_O(t) \) \(= \theta_0 + \alpha_1 \cdot V_i(t) + \alpha_2 \cdot D_{\text{sys}}(t) + \alpha_3 \cdot S_i \)
mit \(\theta_0\): Basiswert der Schwelle % (z.,B. 1.5), und \(\alpha_1\), \(\alpha_2\), \(\alpha_3\): Gewichtungsfaktoren für Volatilität, Druck und Segment.
Interpretation: Die dynamische Schwelle \(\theta_O(t)\) passt sich flexibel an externe Belastungsfaktoren an. Diese Methode erlaubt eine objektive, kontextabhängige Bewertung von Friststabilität im wirtschaftlichen und staatlichen Gefüge.
Fristdeformation, Zeitinvarianz und unrealistisches Leistungserfordernis
Die zuvor beschriebenen Phänomene der Fristdeformation und der Zeitinvarianz stehen in einem direkten Zusammenhang mit einem systemisch erzeugten Mehrleistungserfordernis. Dieses entsteht, obwohl die objektiven Voraussetzungen für eine tatsächliche Erfüllung nicht gegeben sein können und die individuell erbrachte Leistung bereits hinreichend ist.
Logik des Mehrleistungserfordernisses: In einem idealen Verfahren gilt:
\( L_{\mathrm{erforderlich}} \leq L_{\mathrm{max,ind}}, \)
wobei \(L_{\mathrm{erforderlich}}\) die vom System geforderte Leistung und \(L_{\mathrm{max,ind}}\) die maximal mögliche individuelle Leistung ist.
Durch Fristdeformation und Zeitinvarianz verschiebt sich die Systemanforderung jedoch zu:
\(L_{\mathrm{erforderlich}}(t) = L_{\mathrm{basis}} + \phi \cdot \Delta T(t) + \psi \cdot V_J(t), \)
mit:
- \(L_{\mathrm{basis}}\): objektiv notwendige Leistung zur fristgerechten Erledigung,
- \(\Delta T(t)\): Fristabweichung zum Zeitpunkt \(t\),
- \(V_J(t)\): aktuelle Verfahrenslast,
- \(\phi, \psi > 0\): Verstärkungskoeffizienten.
Unmöglichkeit der Erfüllung: Unter Bedingungen stationärer Verfahrenslast \(V_J(t) \equiv \text{const.}\) und positiver Fristabweichung \(\Delta T(t) > 0\) gilt:
\(L_{\mathrm{erforderlich}}(t) > L_{\mathrm{max,ind}} \quad \forall t,\)
selbst wenn \(L_{\mathrm{ind}}(t) \approx L_{\mathrm{max,ind}}\) bereits erbracht wird. Das System erzeugt somit eine permanente Überforderung, die nicht aus mangelnder Leistung, sondern aus der strukturellen Logik resultiert. Normative Konsequenz: Diese Konstellation verletzt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und der Einzelfallgerechtigkeit:
- Verhältnismäßigkeit: Die geforderte Leistung steht in keinem realistischen Verhältnis zur individuellen Leistungsfähigkeit.
- Einzelfallgerechtigkeit: Die tatsächlich erbrachte, hinreichende Leistung wird nicht als Erfüllung anerkannt.
Schlussfolgerung: Fristdeformation und Zeitinvarianz wirken als Verstärker eines systemischen Mehrleistungserfordernisses, das objektiv nicht erfüllbar ist. Die strukturelle Bindung bleibt bestehen, weil das System seine Anforderungen nicht an die realen Leistungsgrenzen anpasst, sondern diese systematisch überschreitet:
\(\Delta B_t \propto \max\{0, L_{\mathrm{erforderlich}} – L_{\mathrm{max,ind}}\}.\)
Damit wird die Verfahrensanhäufung nicht durch mangelnde Leistung, sondern durch ein strukturell erzeugtes, unrealistisches Anforderungsniveau stabilisiert.
Erweiterung: Modell der Leistungserwartung
Neben der objektiven Leistungsanforderung \(L_{\mathrm{erforderlich}}\) existiert eine Leistungserwartung \(E_L(t)\), die das System an die handelnde Person richtet. Diese Erwartung ist nicht rein sachlich begründet, sondern speist sich aus mehreren Einflussfaktoren:
\(E_L(t) = L_{\mathrm{erforderlich}}(t) \) \( + \beta_{\mathrm{inst}} I(t) + \beta_{\mathrm{pol}} P(t) + \beta_{\mathrm{med}} M(t),\)
wobei gilt:
- \(I(t)\): institutionelle Faktoren (z.,B. interne Zielvorgaben, Kennzahlensteuerung),
- \(P(t)\): politische Faktoren (z.,B. Gesetzesinitiativen, symbolische Politik),
- \(M(t)\): mediale Faktoren (z.,B. öffentliche Aufmerksamkeit, Reputationsdruck),
- \( \beta_{\mathrm{inst}}, \beta_{\mathrm{pol}}, \beta_{\mathrm{med}} > 0\): Gewichtungskoeffizienten.
Unausgeschöpftes Leistungspotenzial im Kontext dynamischer Fristbewertung und Liquiditätsrückgang
Es gelte das unausgeschöpfte Leistungspotenzial in dynamischen Systemen zu identifizieren und zu quantifizieren. Dieses Potenzial stellt die Differenz zwischen der maximal möglichen Leistungskapazität und der tatsächlich erbrachten Leistung dar. Seine Bewertung ist entscheidend für die Erkennung systemischer Ineffizienzen, insbesondere im Kontext verkürzter Fristen und sinkender Liquidität.
Es seien;
- Leistungspotenzial \(LP_i(t)\): Die maximal mögliche Leistungskapazität der Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\)
- Ist-Leistung \(L_i(t)\): Die tatsächlich erbrachte Leistung der Einheit \(i\) zum Zeitpunkt \(t\)
- Ausschöpfungsgrad \(A_i(t) = \frac{L_i(t)}{LP_i(t)}\): Verhältnis der Ist-Leistung zur maximalen Leistung
- Unausgeschöpftes Potenzial \(ULP_i(t) = LP_i(t) – L_i(t)\): Differenz zwischen Potenzial und Ist-Leistung.
Zusammenhang mit Fristverkürzung und Liquiditätsrückgang: Eine Verkürzung der verfügbaren Frist \( \Delta T_i(t)\) sowie ein Rückgang der Liquidität \(R_i(t)\) führen typischerweise zu einem Anstieg des unausgeschöpften Potenzials \(ULP_i(t)\). Dieses Verhalten macht \(ULP_i(t)\) zu einem relevanten Indikator für systemische Ineffizienz.
Dann sei;
- \( A_i(t) = \frac{L_i(t)}{LP_i(t)} \) \( \rightarrow \) Ausschopfungsgrad
- \(ULP_i(t) = LP_i(t) – L_i(t)\) \( \rightarrow \) unausgeschoepft
- \( ULP_i(t) \propto \Delta T_i(t),\ R_i(t) \) \( \rightarrow \) Korrelation
References
| ↑1 | Siehe: Nutzwert-Analysen (Multi-Criteria Decision Making, MCDA); Leitfaden zur Anwendung von Methoden der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung – Methode: PROMETHEE, Lehrstuhl für Produktion und Logistik von Prof. Dr. Jutta Geldermann, Nils Lerche Stand: Januar 2014; Analyse und Vergleich von Methoden zur integrierten Bewertung von Infrastrukturmaßnahmen im Schienenverkehr von Rebekka Ott (2012) |
|---|---|
| ↑2 | Siehe auch: Endogene Zeitdiskontierung; “Eine Theorie endogener Zeitdiskontierung“ von Bruno S. Frey und Hans Jürgen Ramser (1974) in der Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Band 1, Seiten 65–82 |
| ↑3 | Siehe: Queuing-Warteschlangenabbildung; Warteschlangen von Christian Dombacher (1994) |